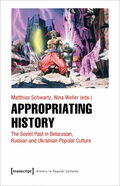Anpassung und Radikalisierung. Dynamiken der Populärkultur(en) im östlichen Europa vor dem Krieg
In den Ländern Ost- und Ostmitteleuropas erfüllt die Populärkultur seit den 1980er Jahren spezifische Funktionen: Sie dient der Vermittlung westlicher Trends, Bilder und Erzählungen ebenso wie der Neudefinition nationaler, religiöser oder auch staatssozialistischer Symboliken und Narrative. Im Hinblick auf Gesellschafts-, Geschichts-, Familien-, Heimat- und andere Identitätsmodelle kann sie Vorstellungen von Modernität, Zeitgeist und materiellem Wohlstand mit sowohl progressiven als auch konservativen Werten verknüpfen. Sie kann zur subkulturellen, oppositionellen bzw. dissidentischen Radikalisierung, aber auch zu eher unkritischem Konsumverhalten und zur Normalisierung von nationalistischen Diskursen beitragen. So erweist sich Populärkultur als Vehikel kollektiver Wünsche und Träume, latenter Frustrationen und Ängste. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ist dabei vor allem interessant, welche ästhetischen und medialen Mittel populärkulturelle Produkte und Praktiken nutzen und wie sie politisch wirkmächtig werden und in der Folge gesellschaftliche Debatten prägen. Um einer einseitigen Betrachtung von Populärkultur als einer Form von Gegenkultur und ›Widerstand‹ gegen kulturelle Hierarchien und Machtstrukturen zu entgehen, müssen dabei stets auch ihre problematischen Potenziale in den Blick genommen werden. Diese sind nicht nur in der Kommerzialisierung zu suchen, sondern auch in der populistischen Radikalisierung und diskursiven Anpassung an politische Machtverhältnisse. Denn als Indikator und Booster gesellschaftlicher Stimmungen kommt der Populärkultur eine Schlüsselrolle beim Verständnis gesellschaftspolitischer Prozesse zu.
Das Verbundprojekt untersucht Entwicklungsdynamiken in den Populärkulturen in Belarus, Polen, Russland, Ukraine und Ungarn seit den 1980er Jahren aus interdisziplinärer und vergleichender Perspektive. Zusammen mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa in Leipzig (GWZO), dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) und der Professur für Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt Polonistik) an der Universität Potsdam werden unter Federführung des ZfL in einer Reihe von Fallstudien unterschiedliche Phänomene und Genres der Populärkultur erforscht. Die Teilprojekte widmen sich aus literaturwissenschaftlicher, historischer sowie kultur- und medienwissenschaftlicher Perspektive populärkulturellen Phänomenen und Figuren in verschiedenen Genres: von Literatur, Film und bildender Kunst über Fernsehserien, Volks- und Popmusik, Videos, Memes, Wandmalerei und Graffiti bis hin zum Politjournalismus und den sozialen Medien. Die vergleichende interdisziplinäre Untersuchung populärkultureller Produkte und Trends verspricht neue Erkenntnisse über deren dynamische Entwicklungen vom euphorischen Aufbruch der Demokratisierung in den 1980er und 1990er Jahren bis zum gegenwärtigen Erstarken nationalistischer Ideologien und rechtspopulistischer bzw. autoritärer politischer Strukturen. Die Anlage des Projekts erlaubt es zudem, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den untersuchten spät- und postsozialistischen nationalen Populärkulturen und ihrer Entwicklung darzustellen.
Über die Arbeit in den einzelnen Teilprojekten hinaus wird im Rahmen des Verbundprojekts ein internationales Forschungsnetzwerk aufgebaut, das darauf abzielt, ein besseres allgemeines Verständnis der generellen Dynamiken und Funktionsweisen von Populärkultur unter den Bedingungen von Digitalisierung und Globalisierung zu gewinnen.
Abb. oben: Festival »Przystanek Woodstock« 2016, Kosztrzyn nad Odrą, © Jakkolwiek, Lizenz CC BY-SA 4.0 Deed
Projektgruppe: Daria Ganzenko (ZZF), Indira Anna Hajnács (GWZO), Aleksandra Szczepan (UP), Nina Weller (ZfL)
Koordination: Aleksandra Szczepan, Nina Weller
Projektwebsite: popular-dynamics.org
Teilprojekte
Partisanen, Kosaken und Rebellen. Figurationen des Widerstands in osteuropäischen Populärkulturen
Bearbeitung: Nina Weller
Der Umgang mit der nationalen und staatssozialistischen Geschichte ist in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion seit deren Ende Gegenstand kontroverser Debatten. Für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit spielen insbesondere populärkulturelle Formate eine wichtige Rolle. Um das Verhältnis von ›Eigenem‹ und ›Fremdem‹, von Macht und Widerstand im kulturellen und ideologisch-politischen Bereich neu zu bestimmen, wird häufig auf historische Mythen zurückgegriffen.
Das Teilprojekt nimmt am Beispiel der belarussischen, ukrainischen und russischen Populärkultur (Film, Literatur, Comics, Musik, Videos u.a.) prominente Figurationen des Widerstands wie den Partisanen, den Kosaken, den Rebellen oder den Verschwörer in den Blick. Es analysiert, welche Funktionen diesen Figuren von unterschiedlichen gesellschaftlichen und künstlerischen Akteuren zwischen den 1960er und 2020er Jahren bei der Bestimmung des historischen Erbes und bei der Neuaneignung der Geschichte im Kontext eigener politischer Positionierungen oder sich formierender Protestbewegungen zugeschrieben wurden. Welche symbolische Rolle kommt ihnen bei der politischen Fremd- und Eigenbeschreibung zu? Inwieweit werden sie medial als Repräsentanten der Anpassung oder aber des Dissidententums, der Radikalisierung, gar der Revolte stilisiert? Wie werden solche Figurationen historischer Mythen revidiert oder instrumentalisiert, wo veränderten sich ihre symbolischen Markierungen im Laufe der Zeit unter sowjetischen, nationalen, imperialen oder auch postkolonialen Vorzeichen? Worin liegt der spezifische Charakter populärkultureller Darstellungen der emanzipativen oder umgekehrt reaktionären Züge derartiger Widerstandsfiguren?
Du wirst nie allein gehen? Zivile und militärische Bildsprache in der polnischen Populärkultur seit den 1980er Jahren
Bearbeitung: Aleksandra Szczepan
Das kollektive Gedächtnis und die kollektive Identität Polens sind von zwei Modi geprägt: dem ›militärischen‹ und dem ›zivilen‹. Der militärische Modus steht für patriarchale, hierarchische und nationalistische Formen der Gemeinschaft, die sich auf die Logik von Eigentum und Konflikt stützen. In der kollektiven Vorstellung Polens ist er allgegenwärtig. Er wurzelt in den Traditionen nationaler Aufstände, militärischer Rebellionen sowie der männlich dominierten politischen Oppositionsbewegungen zur Zeit des Kommunismus und findet seine Verkörperung im nationalistischen Unabhängigkeitsmarsch, der jährlich in Warschau stattfindet.
Der ›zivile‹ Modus hingegen steht für ›unspektakuläre‹ Formen sozialer Interaktion wie Empathie, Höflichkeit und horizontale Solidarität. Er war in der kollektiven polnischen Bildsprache in weitaus subtilerer Form präsent, bevor er im Zuge der Frauenproteste, die im Oktober 2020 als Reaktion auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts entflammten, fast alle Abtreibungen zu verbieten, voll zum Tragen kam. Die landesweiten Proteste machten im Rahmen ihres Einsatzes für eine inklusive Idee von Gemeinschaft kreativen Gebrauch vom polnischen Nationalkanon und den Mitteln der Populärkultur. Ausdruck fand dies unter anderem im Hauptslogan des Streiks: »Du wirst nie allein gehen.«
Ausgehend von diesen Beobachtungen analysiert das Projekt die ›militärischen‹ und ›zivilen‹ Modi des ›Polnischseins‹ in verschiedenen Erscheinungsformen der polnischen Populärkultur, von Literatur, Film, Theater, Kunst und öffentlichen Aufführungen zu Videospielen, Musik, Mode und Social-Media-Phänomenen seit den 1980er Jahren. Untersucht werden ihre Genealogie, ihre klassen- und geschlechtsspezifischen und geografischen Bedingungen sowie deren ständige symbolische Wechselwirkung.
Ein Witz jagt den nächsten: Russischer verbaler Humor vom Spätsozialismus bis zur postsowjetischen Zeit
Bearbeitung: Daria Ganzenko
Dieses Teilprojekt widmet sich verschiedenen Formen des russischen verbalen Humors, die in der Entwicklung der russischen Populärkultur eine entscheidende Rolle gespielt haben. Humoristische Nummern und satirische Monologe, die von Komiker*innen im Fernsehen oder bei Konzerten vorgetragen wurden, bereicherten die Unterhaltungsbühne (estrada) und trugen in der russischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts sowohl zur Indoktrination als auch zur Gesellschaftskritik bei. Stand-up-Comedy, eines der beliebtesten Genres im heutigen Russland, knüpft an dieses Erbe an und legt seine Widersprüchlichkeit offen. Während im russischen Fernsehen ausgestrahlte Stand-up-Formate oftmals die autoritären, xenophoben und traditionalistischen Diskurse untermauern, die den Kern der russischen Kulturpolitik bilden, fordert unabhängige und alternative Stand-up-Comedy das offizielle Narrativ heraus. In beiden Fällen prägen komödiantische Darbietungen die Weltanschauung und das Selbstverständnis ihrer Zuschauer*innen, während sie gleichzeitig soziale, kulturelle und politische Normen und Werte aufdecken. Durch die Schaffung eines bestimmten Typs von komödiantischem Subjekt und Bühnenpersönlichkeit tragen moderne russische Stand-Up-Komiker*innen ganz in der Tradition ihrer Vorgänger*innen wesentlich zur Subjektivierung ihres Publikums bei.
Durch die Analyse der komödiantischen Nummern und Auftritte der einflussreichsten sowjetischen und postsowjetischen russischen Komiker*innen zeichnet dieses Teilprojekt die Kontinuitäten und Lücken in der Entwicklung des verbalen Humors in Russland über die letzten 80 Jahre nach. Unter Berücksichtigung sowjetischer und postsowjetischer Traditionen und Formen des verbalen Humors in verschiedenen (popkulturellen) Kontexten, Medien und innerhalb der globalen Produktionslandschaft humoristischer Formate untersucht das Projekt verschiedene Arten des russischen verbalen Humors und ihre Transformation im Spätsozialismus und der postsowjetischen Zeit.
Folklore als Projektionsfläche. Dynamiken der Neuinterpretation des kulturellen Erbes in Ungarn
Bearbeitung: Indira Anna Hajnács
Ein- und dasselbe Volkslied kann auf dem Parteitag einer rechtskonservativen Partei, in einem ungarischen Tanzhaus in Kanada, in einem Konzertsaal oder auf einem Psytrance-Festival erklingen. Diese so unterschiedlichen Rezipientinnen und Rezipienten erkennen sich alle in diesen Liedern wieder. Der Versuch, die populäre Kultur der ungarischen Landbevölkerung in das Konzept einer nationalen Kultur zu integrieren, führte im Laufe der Geschichte immer wieder zu Neuinterpretationen des kulturellen Erbes. Dabei blieben die Konturen von ›Folklore‹ unscharf: Was jeweils als Folklore galt, hing immer von sozioökonomischen, politischen und kulturellen Bedingungen ab.
Das Teilprojekt untersucht die verschiedenen Konjunkturen der Popularisierung ungarischer Folklore seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Anhand ethnosemiotischer Analysen ausgewählter Praktiken werden Deutungsmuster und Umdeutungsdynamiken hinsichtlich ihrer sozialen, ökonomischen und politischen Hintergründe untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Revitalisierung von Folklore in der musikalischen Produktion. Welche unterschiedlichen, oft gegensätzlichen Erzählungen werden heute mit ungarischen Volksliedern in Verbindung gebracht? Welche bestehenden und welche neuen Machtverhältnisse werden durch volkstümliche Musik symbolisch gestützt?
Populäre Kultur und (Rechts-)Populismus
Bearbeitung: Magdalena Marszałek
Das Teilprojekt beleuchtet punktuell die Räume des Zusammenspiels von populistischen Politiken und populärkulturellen Entwicklungen in Osteuropa mit besonderem Fokus auf Polen. Etymologisch haben der Populismus und das Populäre die gleichen Wurzeln (lat. populus, ›Volk‹; popularis, ›populär‹); sowohl der politische Populismus als auch die populäre Kultur suggerieren ‒ nicht zuletzt durch die Ablehnung des Elitären ‒ eine besondere ›Volksnähe‹. Ist die zunehmende ›Medialisierung‹ der Politik, insbesondere in Zeiten von Social Media, ein umfassendes Phänomen, so lässt sich doch nach spezifischen Verflechtungen populistischer und populärkultureller Performanzen fragen: Welche Allianzen gibt es zwischen Populärkultur und politischem Populismus? Welche Resonanzräume bietet die Populärkultur populistischen Politiken, wann und wo leistet sie Widerstand?
Die Rechtspopulisten artikulieren in der Regel klare kulturpolitische Ziele und interessieren sich dabei auch für breite Bereiche der Populärkultur, die sie ‒ sobald sie an die Macht kommen (wie in Polen in den Jahren 2005–2007 und 2015–2023) ‒ finanziell zu kontrollieren und für eigene politische Zwecke zu vereinnahmen versuchen: seien es Musikfestivals, die Reenactment-Bewegung oder aber populäre Fernsehformate. Das Teilprojekt fragt deshalb nach Momenten der gegenseitigen Verstärkung populärkultureller Ausdrucksweisen und populistischer Machtstrategien wie auch nach möglichen Widersprüchen und Rissen in den Praktiken und Diskursen der rechtskonservativen und nationalistischen Liaison von populärer Kultur und Populismus.
Nicht zuletzt geht es auch um die Frage, wie Cultural Studies und die Populismusforschung voneinander profitieren können: In der Populismusforschung wird seit einiger Zeit immer wieder postuliert, neben den ›harten‹ Kriterien wie Ökonomie oder Demografie auch kulturelle Aspekte bei der Untersuchung und Erklärung des gegenwärtigen Aufstiegs des Populismus zu berücksichtigen; und umgekehrt kann der Blick auf die populärkulturellen und populistischen Allianzen die bisher von den Cultural Studies wenig beachtete Seite der Politisierungsprozesse in der populären Kultur beleuchten und somit neue Anregungen für die Diskussion um den Hauptgegenstand der Cultural Studies liefern.
Misstrauen und Verachtung. Populäre Fernsehserien und Late-Night-Shows im medialen und gesellschaftlichen Wandel
Bearbeitung: Matthias Schwartz
Als Traumfabrik und Wahrheitsmedium spielt das Fernsehen nach wie vor eine Schlüsselrolle bei der Herausbildung von Vorstellungswelten, politischem Selbstverständnis und der sozialen Positionierung des Publikums. Digitale Medienformate wie Serien und politische Talkshows können enorme Anziehungskraft und Massenwirkung entfalten und Weltbilder und Einstellungen zur Wirklichkeit nachhaltig prägen. Dies zeigte beispielsweise der Erfolg von Wolodymyr Selenskyj, der die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine 2019 gewann, nachdem er zuvor nationale Beliebtheit als Serienschauspieler und Comedian erlangt hatte. Dabei bedienen diese Medienformate häufig ein weitverbreitetes Misstrauen gegenüber den Herrschenden, sie schüren Ängste vor Veränderungen oder auch Ressentiments gegen vermeintlich Fremde, die sie in spannende Plots und eingängige Geschichten verwandeln.
Das Teilprojekt beschäftigt sich anhand ausgewählter Fernsehserien und Late-Night-Shows aus Polen, Russland und der Ukraine mit der Frage, wie diese Medienformate die Vorstellungen von Gesellschaft, Individuum und politischem Handeln beeinflussen. Ziel ist es dabei, über die konkreten Fallstudien hinaus auch in diachroner und vergleichender Perspektive genauere Erkenntnisse über den Wandel populärkultureller Formate und ihrer künstlerischen Gestaltung zu gewinnen.
Publikationen
Appropriating History
The Soviet Past in Belarusian, Russian and Ukrainian Popular Culture
Matthias Schwartz
- In der Finsternis des Krieges. Der ukrainische Bestseller-Autor Illarion Pavliuk, in: ZfL Blog, 18.12.2025
- In a Lad’s World. A Popular TV Series and Social Media in the Shadow of the Russo-Ukrainian War, in: Философия – Filosofiya – Philosophy 33.3 (2024), 98–110
- Introduction: Popular Culture and History in Post-Soviet Nation States, in: Matthias Schwartz, Nina Weller (Hg.): Appropriating History. The Soviet Past in Belarusian, Russian and Ukrainian Popular Culture. Bielefeld: transcript 2024, 11–26 (mit Nina Weller)
- Come and See, Once Again. A Russian Television Series on the Seventh Symphony in Defeated Leningrad, in: ebd., 265–290
- In der Welt der wilden Kerle. Eine populäre Serie im Zeichen des russisch-ukrainischen Krieges, in: ZfL Blog, 12.7.2024
Nina Weller
- Drei Fragen an … Nina Weller, Evangelische Akademie Tutzing, 28.10.2024
- Introduction: Popular Culture and History in Post-Soviet Nation States, in: Matthias Schwartz, Nina Weller (Hg.): Appropriating History. The Soviet Past in Belarusian, Russian and Ukrainian Popular Culture. Bielefeld: transcript 2024, 11–26 (mit Matthias Schwartz)
- Partisan, Anti-Partisan, pARTisan, Party-Zan, Cyberpartisan. On the Popularity of Partisanhood in Belarusian Culture, in: ebd., 155–185
- URIS Workshop: Documenting War in Ukraine in Comics (Bericht)
Veranstaltungen
Imagined Pasts, Invented Traditions
Staatliche Universität Jerewan, 1 Alek Manukyan St, 0025 Jerewan, Armenien
Sofiya Filonenko: Contemporary Ukrainian Bestseller: Celebrities, Trends and Readership
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Eberhard-Lämmert-Saal, Eingang Meierottostr. 8, 10719 Berlin / hybrid
Potential Solidarities. (Popular) Cultural Alliances and Political Engagements with and within East-Central Europe
Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10, Haus 8, Raum 0.60/0.61, 14469 Potsdam / Einstein Forum, Am Neuen Markt 7, 14467 Potsdam
Common Resentments, Diverging Plots: Forms and Functions of Popular Conspiracy Culture in Eastern Europe
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Ilse-Zimmermann-Saal, Pariser Str. 1, 10719 Berlin
Eliot Borenstein (NYU): Speak of the Devil. The Putinist Crusade against Satan at Home and Abroad
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Eberhard-Lämmert-Saal, Eingang Meierottostr. 8, 10719 Berlin
Literatur in Tamvydat und Digvydat
Universität Graz
Nina Weller: Der Partisanenmythos und seine Reise durch (populär)kulturelle Aneignungen und Umkodierungen
Universität Graz
Digital Tools, Radical Views, Appealing Aesthetics. Comparative Approaches to Popular Culture from Eastern Europe
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Ilse-Zimmermann-Saal, Pariser Str. 1, 10719 Berlin
Horror & Melodrama: Die sowjetische Vergangenheit in der Populärkultur von Belarus, Ukraine und Russland
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Eberhard-Lämmert-Saal, Eingang Meierottostr. 8, 10719 Berlin
Matthias Schwartz: ‘Kresy’ as a Combat Zone: Ukrainian, Belarusian, and Russian Borderlands in Poland‘s Popular Culture
GCSC (International Graduate Centre for the Study of Culture), Otto Behaghel Str. 12, 35394 Gießen
Nina Weller: Partisanen, Kosaken und Rebellen. Figurationen des Widerstands in osteuropäischen Populärkulturen
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Slawistik und Hungarologie, Raum 5.57, Dorotheenstr. 65, 10117 Berlin
Matthias Schwartz: »Liebe in Ketten«. Zur gesellschaftspolitischen Funktion von Populärkultur am Beispiel aktueller polnischer Fernsehserien
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Slawistik und Hungarologie, Raum 5.57, Dorotheenstr. 65, 10117 Berlin
Matthias Schwartz: Selenskyj und die Serie »Diener des Volkes«: Zum Verhältnis von Unterhaltung, Populismus und Politik in zeitgenössischen Populärkulturen
Universität Hamburg, Hauptgebäude, Edmund-Siemers-Allee 1, Flügel Ost, Raum 221, 20146 Hamburg
Nina Weller: Osteuropaforschung in Zeiten des Krieges: Öffentlichkeit, Aktivismus, Selbstbefragung
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Eberhard-Lämmert-Saal, Eingang Meierottostr. 8, 10719 Berlin
Filming the Far Right in Poland and Hungary
Kino Krokodil, Greifenhagener Str. 32, 10437 Berlin
Nina Weller: »Der Westen im Osten«. Konstruktionen des Westens in der russischen Populärkultur
Evangelische Akademie Tutzing, Schlossstraße 2+4, 82327 Tutzing
Populismus: Interdisziplinäre Perspektiven
Universität Potsdam, Institut für Slavistik, Campus I, Haus 9, HS 1.02, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam
Matthias Schwartz: In a Lad’s World. A popular TV series and social media in the shadow of the Russo-Ukrainian War
Sofia Universität »St. Kliment Ohridski«
Nina Weller: Kastus Kalinoûski as the “pop star” of the Belarusian struggle for independence
Sofia Universität »St. Kliment Ohridski«
Nina Weller: Literature and Cinema in Dialogue. Vasyl Bykau’s and Ales Adamovich’s Correspondence on Ethics of Narrating the Past
European Humanities University, room 110, Savičiaus g. 17, 01126 Vilnius, Litauen
Polnische populäre Kultur in Zeiten des autoritär-nationalistischen Populismus
Technische Universität Dresden
Matthias Schwartz: Kresy as a War Zone: Ukrainian, Belarusian and Russian Borderlands in Popular TV Series from Poland
GCSC (International Graduate Centre for the Study of Culture), Otto Behaghel Str. 12, 35394 Giessen
Zweiter Blick: A-Ja: Wie übersetzt sich »Krieg«?
Universitätsbibliothek Leipzig, Vortragssaal Bibliotheca Albertina, Beethovenstr. 6, 04107 Leipzig
Popular Culture, Social Media and Populist Politics. Perspectives from Eastern Europe
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Ilse-Zimmermann-Saal, Pariser Str. 1, 10719 Berlin
Nina Weller: Die »Verbrannten Dörfer« von Belarus. Zur Entstehung und Rezeption des »Feuerdorfbuchs« von A. Adamovič, J. Bryl, U. Kalesnik
Slavisches Seminar der Universität Tübingen, Hörsaal 426, Wilhelmstraße 50, 72074 Tübingen
Matthias Schwartz: »Wie die Kosaken«. Volodymyr Zelenskyj als Schauspieler, Komiker und Populist
Universität Potsdam, Raum 1.11.2.27
Matthias Schwartz: Das Ewige Katyn. Der Streit um die Geschichte in polnischer Populärkultur
Universitätsbibliothek Bochum, Universitätsstr. 150, 44801 Bochum
Viktor Martinowitsch: »Nacht«
Museum Folkwang, Museumsplatz 1, 45128 Essen
Lyrik-Salon mit Volha Hapeyeva
Altes Gymnasium Neuruppin, Schulplatz
Literature about WWII: Constructing Memory
FernUniversität in Hagen, Campus Berlin, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin
Nacht der unerschossenen Gedichte. Eine Begegnung mit ausgelöschter und gegenwärtiger belarusischer Literatur
Haus für Poesie, Knaackstr. 97, 10435 Berlin
Nina Weller: Partizanstvo und Protest. Figurationen des Widerstands in der belarusischen Kultur
Universität Würzburg
Medienecho
Workshopbericht von Katharina Kelbler, in: H-Soz-Kult (27.10.2025)
Workshopbericht von Katharina Kelbler, in: H-Soz-Kult (10.6.2025)
Beiträge
25.1.2025 Audio
»Vergessene Kriege«
Interview mit Nina Weller im WDR3
© WDR
1.3.2024
»Zwischen ›Extremismus‹, Schweigen und Exil. Zur Lage der belarusischen Literatur«
Gespräch mit Alhierd Bacharevič und Nina Weller, moderiert von Nina Frieß, im Podcast Roundtable Osteuropa
© Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS)
23.2.2024
»Zweiter Blick: A-Ja: Wie übersetzt sich ›Krieg‹?«
Ostap Slyvynsky und Maria Weissenböck im Gespräch mit Nina Weller
© Universitätsbibliothek Leipzig