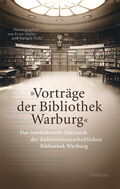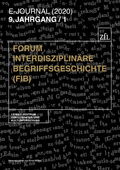Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen. Lexikon zur historischen Semantik in Deutschland
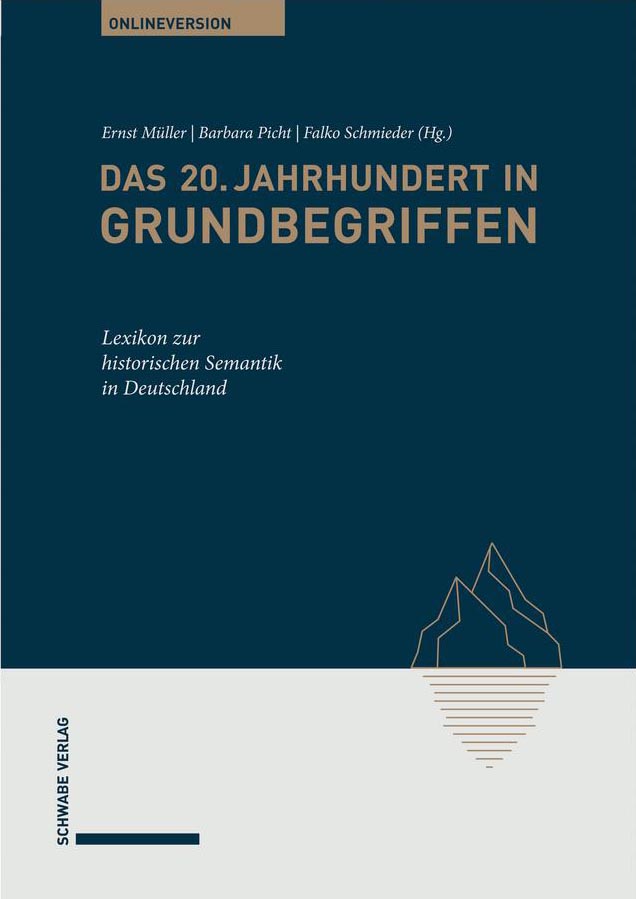
Das 20. Jahrhundert ist ein begriffsgeschichtlich noch zu vermessendes Terrain. In einem Verbundprojekt, das im Rahmen des Programms Leibniz-Kooperative Exzellenz unterstützt wird, soll unter der Federführung des ZfL in enger Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für deutsche Sprache (IDS) in Mannheim und dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) ein Lexikon der Grundbegriffe dieses Jahrhunderts entstehen. Unter Einbezug einer Vielzahl von weiteren historisch arbeitenden Wissenschaftlern der geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächer soll die politisch-soziale und kulturelle Semantik in Deutschland erschlossen werden. Das Lexikon wird von Ernst Müller, Barbara Picht und Falko Schmieder in Kooperation mit Mark Dang-Anh, Alexander Friedrich, Rüdiger Graf und Stefan Scholl herausgegeben. Redakteurin ist Anja Keith.
Das Projekt versteht sich als ein interdisziplinäres, wissens- und sozialgeschichtlich ausgerichtetes Forschungsunternehmen, das keinesfalls nur gesichertes Wissen festschreiben, sondern experimentell der Grundlagenforschung der Geistes-, Kultur-, Sozial- und historischen Wissenschaften dienen soll. Als Beginn des Untersuchungszeitraums bestimmen wir die von Neuzeit-, aber auch Kulturhistorikern akzentuierte problemgeschichtliche Schwellensituation ›um 1900‹, die oft auch als Beginn der Hochmoderne oder der ästhetischen Moderne angesehen wird. Das Projekt knüpft kritisch an die mit dem Namen Reinhart Koselleck verbundenen Geschichtlichen Grundbegriffe an. Anders als diese gehen wir nicht von einer (zweiten) Sattelzeit aus. Vielmehr stellt sich uns das 20. Jahrhundert als ein vielfältig frakturiertes und widersprüchliches, pluritemporales Jahrhundert dar, dessen Semantik durch Ungleichzeitigkeiten, beschleunigten Verschleiß, begriffliche Innovationen und Bezeichnungsrevolutionen, aber auch durch erstaunliche Kontinuitäten, Wiederholungsstrukturen und zyklische Verläufe geprägt ist. Die Verknüpfung von Geschichtsphilosophie und (Sozial-)Strukturgeschichte als epistemischer Grundrahmen der Geschichtlichen Grundbegriffe (mit der latenten Gefahr einer begriffsrealistischen Ontologie) wird aufgelöst zugunsten des Interesses an Austauschprozessen zwischen wissenschaftlicher, literarästhetischer, politischer und alltäglicher Sprache, also an der ganzen Vielfalt der Formen und Verfahren der Generierung und Zirkulation von Bedeutungen.
Das Lexikon präsentiert nicht nur die politisch-soziale, sondern auch die kulturelle Semantik. Damit ist sowohl eine Ausweitung des Gegenstandsfelds verbunden, als auch eine Veränderung der Heuristik und Methodik der Untersuchungen sowie ein erweitertes Verständnis von ›Grundbegriff‹. Eine These ist, dass neue Grundbegriffe im 20. Jahrhundert wesentlich durch die Wissenschaften geprägt werden. Mit der Ausdifferenzierung der Einzelwissenschaften, die seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die Philosophie als Universaldiskurs ablösen, und mit der Entstehung pluraler, auf neue Medien basierender und auf soziale Massen zielender Öffentlichkeiten können dabei die Formen und Zusammenhänge der Bedeutungsproduktion nur mehr in einer interdisziplinären und wissensgeschichtlichen Perspektive erschlossen werden. Zu den neuen wissenschaftlichen Einzeldisziplinen, die zur Quelle der politischen Semantik werden, gehören insbesondere die Soziologie, Kulturwissenschaften, Religionswissenschaften, Ethnologie, ebenso wichtige Bereiche der Lebenswissenschaften wie Genetik, Experimentelle Psychologie, Psychoanalyse und schließlich die angewandten Arbeitswissenschaften.
Zur Veränderung des Gegenstandsfelds gehört auch die Untersuchung neuer Begriffstypen. Dazu gehören Prozesskategorien mit dem Suffix -isierung, die überhaupt erst im 20. Jahrhundert als neue Form von Grundbegriffen auftauchen; darüber hinaus auch Begriffe ›mittlerer Reichweite‹, die nicht das ganze Jahrhundert durchlaufen, sondern kurzfristigere Konjunkturverläufe aufweisen. Sie verweisen auf Veränderungen der inneren Historizität bzw. historischen Tiefendimensionen von Begriffen, denen ein besonderes Interesse des Lexikons gilt.
Der Erweiterung des Gegenstandsfelds korrespondiert eine Innovation der Methodik. Die zunehmende Verfügbarkeit großer digitaler Korpora erlaubt inzwischen eine großräumige – über spezifische Domänen und theoriesprachliche Zusammenhänge hinausgehende – Erschließung der Semantiken des politisch-sozialen Diskurses. Auf begriffsgeschichtliche Fragestellungen zugeschnittene Analysemethoden eröffnen die Möglichkeit, enorm große, mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr zu bewältigende Textbestände quantitativ zu analysieren und in Hinsicht auf die Semantiken qualitativ auszuwerten. Das Projekt betritt auch diesbezüglich Neuland. Die drei beteiligten Leibniz-Institute ZfL, IDS und ZZF bringen die in den verschiedenen Disziplinen Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Geschichtswissenschaft entwickelten Tools COSMAS, DiaCollo und SCoT erstmals zusammen und erproben damit neue Wege und Methoden der interdisziplinären digitalen Begriffsgeschichte.
Die digitalen Tools erlauben eine synchrone wie diachrone Analyse der historischen Semantik politisch-sozialer Grundbegriffe in großen Korpora. Für das Projekt werden dafür umfassende Textbestände – bestehend aus unterschiedlichsten Textgattungen und Quellen einschließlich Zeitungen, Fachjournalen, Sachbüchern, Romanen, Parlamentsprotokolle und Onlinenachrichten – für das 20. Jahrhundert erstmals systematisch erschlossen. Während sich mit COSMAS die häufigsten Wortbildungen und Phrasen samt typischer Kontexte ermitteln und deren Verteilung mit DiaCollo diachron darstellen lassen, ermöglicht SCoT die Detektion, Visualisierung und Analyse unterschiedlichen Bedeutungen von Begriffsworten und ihrer Entwicklung ihrer Semantik über die Zeit. Mit unterschiedlichen, sich ergänzenden Funktionalitäten ausgestattet ermöglichen die Tools so eine in dieser Größenordnung bisher noch nicht erreichte Verbindung von close und distant reading.
Neben den Möglichkeiten, die die Digital Humanities gerade für die Analyse technisch-medial vermittelter massendemokratischer Gesellschaften bieten, erscheinen zur Untersuchung der Semantiken des 20. Jahrhunderts viele weitere der in den vergangenen Jahren neu oder weiterentwickelten Methoden vielversprechend, die je nach Gegenstand kombiniert zur Anwendung kommen können. Dazu gehören:
- die Verbindungen zur Wissenschafts- und Wissensgeschichte,
- die Reflexion semantischer Übertragungen zwischen Sprachen verschiedener Funktionssysteme sowie der Alltagssprache,
- verfeinerte Methoden der Analyse durch die Sprachpragmatik,
- die Öffnung zu angrenzenden Methoden wie Diskursanalyse oder Metaphorologie,
- die Hinwendung zur kulturellen Semantik, die auch Bedeutungen jenseits ihrer sprachlichen Fixierungen einbezieht.
Insgesamt knüpfen wir an das Projekt die Erwartung, dass die Begriffsgeschichte durch ihr Interesse an der Medialität der Sprache und den Eigendynamiken sprachlicher Prozesse einen spezifischen Blick auf dieses Jahrhundert werfen kann und so möglicherweise auch zu anderen Ergebnissen kommt als eine stark synthetische oder an den politischen Zäsuren orientierte (Sozial-)Geschichtsschreibung.
Im Rahmen des Gesamtprojekts nehmen die drei kooperierenden Institute gemäß ihrer spezifischen Expertisen jeweils einen bestimmten Typus von Grundbegriff in den Blick.
Abb. oben: Naomi Booth, Quelle: Pixabay
seit 2025 zusätzliche Förderung durch den Leibniz-Forschungsverbund »Wert der Vergangenheit«
Laufzeit: seit 2020
Kooperationspartner: Leibniz-Institut für deutsche Sprache (IDS), Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF), Language Technology Group an der Universität Hamburg
Bearbeitung (ZfL): Alexander Friedrich, Anja Keith (Redaktion), Ernst Müller, Barbara Picht
siehe auch
- Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte (FIB) (E-Journal, Open Access, seit 2012)
- Beiträge zur Begriffsgeschichte (im ZfL Blog)
- Theorie und Konzept einer interdisziplinären Begriffsgeschichte (Ernst Müller, Barbara Picht, Falko Schmieder, Projekt 2008–2019)
- ZZF Podcast: Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen (mit Rüdiger Graf und Simon Specht, 27.3.2024)
Teilprojekte
Politisch-soziale Grundbegriffe wissenschaftlicher Provenienz
Bearbeitung: Alexander Friedrich (bis 2024), Ernst Müller, Barbara Picht
In dem am ZfL angesiedelten Teilprojekt werden vor allem Begriffe untersucht, die dem wissenschaftlichen Diskurs entstammen und zwischen den Disziplinen und in den politisch-sozialen sowie den Alltagsdiskurs wandern. Hierzu zählen Begriffe wie ›Diversität‹, ›Energie‹, ›Evolution‹, ›Funktion‹, ›Gen‹, ›Generation‹, ›Geschlecht‹, ›Information‹, ›Kommunikation‹, ›Medien‹, ›Nachhaltigkeit‹, ›Natur‹, ›Netz‹, ›Ökologie‹, ›Prävention‹, ›Prognose‹, ›Rasse‹, ›Regulation‹, ›Struktur‹, ›Theorie‹, ›Trauma‹, ›Umwelt‹. Dieser Begriffstypus ist für die politisch-soziale Sprache des 20. Jahrhunderts spezifisch, die sich durch ihn von vorangegangenen Jahrhunderten unterscheidet. An ihm lässt sich die Tendenz einer abnehmenden Beständigkeit bzw. schnelleren Verfallszeit von Begriffen ablesen, die mit einer Verflüssigung von Bedeutungen einhergeht. Diese ergibt sich vor allem daraus, dass die Begriffe bei ihren vielfältigen Wanderungen zwischen verschiedenen sozialen Sphären ihre Konkretion verlieren und als beliebig besetzbare Leerformeln oder Worthülsen fungieren können. Eine Frage ist, ob für diesen Typ von Grundbegriffen die von Koselleck herausgestellte Spannung von Erfahrung und Erwartung noch zutrifft und welche neuen Formen sie möglicherweise annimmt. Im Vergleich mit Kosellecks Geschichtlichen Grundbegriffen dokumentiert dieser Begriffstyp auch eine Verschiebung prägender Semantiken von der geschichts- und sozialphilosophischen auf die wissenschaftspolitische Ebene, die unter den Stichworten einer Verwissenschaftlichung des Sozialen oder einer Politisierung der Wissenschaften gefasst wurde.
Das Projekt kann an langjährige ZfL-Erfahrungen einer interdisziplinären Wissens- und Sozialgeschichte anschließen. Um die zwischen den Wissenskulturen und Disziplinen mit großer Streuweite wandernden Termini angemessen erfassen zu können, kommen nun zusätzlich auch neue Werkzeuge für eine digitale Begriffsgeschichte zum Einsatz, die in der Lage sind, Cluster oder Domänen unterschiedlicher disziplinärer Verwendungen synchron und diachron zu analysieren. Eines dieser Tools ist die Open-Source-Software SCoT (Sense Clustering over Time), die für die Detektion und Analyse der Bedeutung von Wörtern und ihres Wandels über die Zeit verwendet werden kann. Das Tool steht den Autor*innen des Lexikons, aber auch anderen Interessierten frei zur Verfügung, Fragen zu begriffsgeschichtlichen Analysen mit SCoT können in einer regelmäßig angebotenen digitalen Sprechstunde besprochen werden.
Politisch-soziale Grundbegriffe großer Reichweite und Dauer
Bearbeitung: Stefan Scholl
Das IDS-Projekt nimmt eine Auswahl politischer Grundbegriffe in den Blick. Es fokussiert dabei politisch relevante Teilkorpora, wie z.B. den publizistischen Diskurs der Nachkriegszeit, die Parlamentsprotokolle des 20. Jahrhunderts oder politische Reden während des Nationalsozialismus. Im Zentrum steht dabei die korpusbasierte Analyse begriffskonstituierenden Sprachgebrauchs und dessen methodische Kontextualisierung.
Politisch-soziale Zeit- und Prozessbegriffe
Bearbeitung: Simon Specht
Das ZZF-Projekt untersucht die Veränderung von Begriffen, die Zeitlichkeit und historischen Wandel zum Ausdruck bringen. Im Zentrum stehen dabei Begriffe wie ›Fortschritt‹, ›Krise‹, ›Entwicklung/Evolution‹, ›Modernisierung‹, ›Zukunft‹ oder ›Utopie‹, die politisch umstritten waren und deren gesellschaftliche Diskussion immer wieder zur Bestimmung des eigenen Ortes in der Geschichte diente.
Publikationen
Contributions to the History of Concepts
FORUM INTERDISZIPLINÄRE BEGRIFFSGESCHICHTE
E-JOURNAL (2024/25) 13./14. JAHRGANG / 1
DOI 10.13151/fib.2025.01
unter Mitarbeit von Mark Dang-Anh, Alexander Friedrich, Rüdiger Graf und Stefan Scholl
Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen
Lexikon zur historischen Semantik in Deutschland
»Vorträge der Bibliothek Warburg«
Das intellektuelle Netzwerk der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg
FORUM INTERDISZIPLINÄRE BEGRIFFSGESCHICHTE (FIB)
hg. von Tatjana Petzer
E-JOURNAL (2023) 12. JAHRGANG / 1
DOI 10.13151/fib.2023.01
in Zusammenarbeit mit Annett Martini
Lazar Gulkowitsch: Schriften zur begriffsgeschichtlichen Methode 1934–1940/41
FORUM INTERDISZIPLINÄRE BEGRIFFSGESCHICHTE (FIB)
DOI 10.13151/fib.2022.01
Begriffsgeschichte des 20. Jahrhunderts
Themenheft des Archivs für Begriffsgeschichte
FORUM INTERDISZIPLINÄRE BEGRIFFSGESCHICHTE (FIB)
hg. von Ernst Müller und Falko Schmieder
E-JOURNAL (2021) 10. JAHRGANG / 1
DOI 10.13151/fib.2021.01
Begriffsgeschichte
zur Einführung
FORUM INTERDISZIPLINÄRE BEGRIFFSGESCHICHTE (FIB)
hg. von Ernst Müller und Wolfert von Rahden
E-JOURNAL (2020) 9. JAHRGANG / 1
- Ernst Müller, Barbara Picht, Falko Schmieder: Einleitung, in: dies. (Hg.): Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen. Lexikon zur historischen Semantik in Deutschland. Basel: Schwabe Verlag 2024
Ernst Müller
- Einleitung, in: Ernst Müller, Barbara Picht (Hg.): »Vorträge der Bibliothek Warburg«. Das intellektuelle Netzwerk der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Göttingen: Wallstein 2023, 1–32 (mit Barbara Picht)
- Franz Dornseiff über Das Beispiel. Onomasiologie und Orientalistik im Kontext Aby Warburgs und der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek, in: ebd., 197–213
- Das Netzwerk im Wörterbuch? Erich Rothackers Privatissime-Vortrag über das Kulturphilosophische Wörterbuch, in: ebd., 261–278
- La compensación como crítica resignada a la alienación, in: Juan de Dios Bares Partal, Faustino Oncina Coves (Hg.): La Escuela histórico-conceptual de Joachim Ritter. Granada: Editorial Comares 2022, 37–46
- El descubrimiento del valor emocional en la historia conceptual, in: Quaderns de filosofia 9.1 (2022) = Emociones en la historia conceptual. La historia como emoción, hg. von Antonio Gómez Ramos und Manuel Orozco Pérez, 19–32
- Totalität, in: Eva Geulen, Claude Haas (Hg.): Formen des Ganzen. Göttingen: Wallstein 2022, 55–64
- El conflicto de la Universidad / El conflicto de las Facultades, in: Maximiliano Hernández Marcos, Héctor del Estal Sánchez (Hg.): Conceptos en disputa, disputas sobre conceptos. Madrid: Dykinson 2022, 139–152
- El concepto »espíritu del pueblo« y la historicidad del derecho. Savigny y Hegel, in: Manuel Ángel Bermejo Castrillo (Hg.): Temporalidades inter/disciplinares (Derecho, Filosofía, Política). Madrid: Dykinson 2021, 143–160
- ›Kristallisation‹ und ›Verflüssigung‹ als Metaphern der Geschichtstheorie, in: Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte 10.1 (2021), hg. von Ernst Müller und Falko Schmieder, 38–45
- Wende, in: Faltblatt zum ZfL Jahresthema 2020/21: EPOCHENWENDEN sowie auf dem ZfL Blog, 16.11.2020
Barbara Picht
- Einleitung, in: Ernst Müller, Barbara Picht (Hg.): »Vorträge der Bibliothek Warburg«. Das intellektuelle Netzwerk der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Göttingen: Wallstein 2023, 1–32 (mit Ernst Müller)
- Historiker an der KBW. Hans Liebeschütz, Percy Ernst Schramm, Richard Salomon und Karl Brandi, in: ebd., 87–122
- La contribución de la Escuela de Ritter al Diccionario Histórico de Filosofía, in: Juan de Dios Bares Partal, Faustino Oncina Coves (Hg.): La Escuela histórico-conceptual de Joachim Ritter. Granada: Editorial Comares 2022, 225–237
- La disputa del historicismo, in: Maximiliano Hernández Marcos, Héctor del Estal Sánchez (Hg.): Conceptos en disputa, disputas sobre conceptos. Madrid: Dykinson 2022, 175–185
- Teorías temporales de la modernidad comparadas: Braudel, Koselleck, Bauman, in: Manuel Ángel Bermejo Castrillo (Hg.): Temporalidades inter/disciplinares (Derecho, Filosofía, Política). Madrid: Dykinson 2021, 191–203
- Schiefrunde Perlen. Zum Deutungsanspruch metaphorischer Epochennamen, in: Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte 10.1 (2021), hg. von Ernst Müller und Falko Schmieder, 6–12
Falko Schmieder
- Soziodizee des Kapitalismus [Rezension zu: Armin Nassehi: Gesellschaftliche Grundbegriffe. Ein Glossar der öffentlichen Rede, München: Beck 2023], in: ZfL Blog, 17.4.2024
- Beschleunigungsaxiom, in: Geschichtstheorie am Werk / Theory of History at Work, 18.4.2023
- La crítica de Odo Marquard a la filosofía de la historia y su contraprogramade una filosofía de la compensación, in: Juan de Dios Bares Partal, Faustino Oncina Coves (Hg.): La Escuela histórico-conceptual de Joachim Ritter. Granada: Editorial Comares 2022, 81–98
- El concepto de supervivencia como instrumento para la política del miedo: la colonización de la vida cotidiana en los discursos de la guerra nuclear y de la ecología, in: Quaderns de filosofia 9.1 (2022) = Emociones en la historia conceptual. La historia como emoción, hg. von Antonio Gómez Ramos und Manuel Orozco Pérez, 147–164
- La disputa del positivismo en la sociología alemana, in: Maximiliano Hernández Marcos, Héctor del Estal Sánchez (Hg.): Conceptos en disputa, disputas sobre conceptos. Madrid: Dykinson 2022
- Sobre la política de la asimultaneidad en Ernst Bloch, Walter Benjamin y Theodor W. Adorno, in: Manuel Ángel Bermejo Castrillo (Hg.): Temporalidades inter/disciplinares (Derecho, Filosofía, Política). Madrid: Dykinson 2021, 229–246
- Geschichtsmetaphern und ihre Geschichte. Eine Auseinandersetzung mit Reinhart Koselleck, in: Forum Interdisziplinäre Begriffsgeschichte 10.1 (2021), hg. von Ernst Müller und Falko Schmieder, 25–37
Das Projekt knüpft an die langjährigen Forschungen zur Theorie und Praxis interdisziplinärer Begriffsgeschichte an, aus denen unter anderem diese Publikationen hervorgegangen sind:
Ernst Müller, Falko Schmieder
- Begriffsgeschichte zur Einführung. Hamburg: Junius 2020
- Begriffsgeschichte und historische Semantik. Ein kritisches Kompendium. Berlin: Suhrkamp Verlag 2016, 2. Auflage 2019
- Hg.: Begriffsgeschichte der Naturwissenschaften. Zur historischen Dimension naturwissenschaftlicher Konzepte. Berlin, New York: de Gruyter Verlag 2008
Veranstaltungen
Falko Schmieder: Begriffsgeschichte und historische Semantik. Ein kritisches Kompendium
Moldova-Institut Leipzig e.V., 04109 Leipzig
Falko Schmieder: Geschichte und historische Zeit im Anthropozän
Universität Bielefeld Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie, Universitätsstraße 25. D-33615 Bielefeld
Zeitgeist im Glossar? – Interdisziplinäre Zugänge und zeitdiagnostische Einordnung zum öffentlichen Sprachgebrauch nach der Jahrtausendwende
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS), R5 6-13, Vortragssaal, 68161 Mannheim
Politische Semantik in der DDR
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Ilse-Zimmermann-Saal, Pariser Str. 1, 10719 Berlin
Falko Schmieder: On Hegel’s Metaphorics Between Natural History and History
Universität São Paulo, Fakultät für Philosophie und Sozialwissenschaften, Av. Prof. Luciano Gualberto, 315, São Paulo, Brasilien
Falko Schmieder: On Metaphor – Hegel’s Journey Between Natural History and History
Federal University of Amazonas, Av. Rodrigo Otávio, 6200 - Coroado I, Manaus - AM, 69077-000, Brasilien
Falko Schmieder: The 20th Century in Basic Concepts. A Dictionary of Historical Semantics in Germany
Universität Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, Italien
Falko Schmieder: Reinhart Koselleck in the Anthropocene: historical-epistemological positioning of the history of concepts
Universidad Nacional de San Martín, Av. 25 de Mayo y Francia, B1650 San Martín, Buenos Aires, Argentinien und online
Falko Schmieder: Begriffsgeschichte und Wissenschaftsgeschichte. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven
Staatliche Universität Moldau, Strada Alexei Mateevici 60, Chișinău 2009, Republik Moldau
Falko Schmieder: Überlegungen zur Begriffsgeschichte von Grenze im 20. Jahrhundert
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Logenhaus 101/102, Logenstraße 11, 15230 Frankfurt (Oder)
The Dismeasure of Value // Die Maß-losigkeit des Werts
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Rückkehr des Ganzen. Aktuelle Gesellschaftstheorien und das Problem der Totalität
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Geschichte und Gewalt
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Falko Schmieder: Geschichtsmetaphern und ihre Geschichte. Eine Auseinandersetzung mit Reinhart Koselleck
Balance Hotel Leipzig Alte Messe, Konferenzraum, Breslauer Str. 33, 04299 Leipzig
Falko Schmieder: Der Begriff der Grenze. Grenze im Globalisierungsdiskurs
Balance Hotel Leipzig Alte Messe, Konferenzraum, Breslauer Str. 33, 04299 Leipzig
Negative Dialektik und Erkenntnispraxis. Eine materialistische Philosophie für die Gegenwart
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Falko Schmieder: Nachhaltigkeit – Wachstumskonzept zwischen Utopie und Ideologie
Karlsruher Institut für Technologie, Kaiserstraße 12, Geb. 50.31, SR 12, 76131 Karlsruhe
Zur Kritik des Hegelmarxismus
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Ernst Müller/Barbara Picht: »Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen«. Zu Programmatik und Entstehen eines begriffsgeschichtlichen Lexikons
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Logenhaus 101/102, Logenstraße 11, 15230 Frankfurt (Oder)
Falko Schmieder: Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen
Karlsruher Institut für Technologie, Fritz-Haber-Weg 7, Franz-Schnabel-Haus (Geb. 30.91), Raum 012, 76131 Karlsruhe
Adornos Erben
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Barbara Picht: ›Generation‹ – ein Grundbegriff des 20. Jahrhunderts
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Logenhaus 101/102, Logenstraße 11, 15230 Frankfurt (Oder)
Falko Schmieder: Ernst Blochs Hoffnungsutopien in den Exilen der Geschichte
Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, 67061 Ludwigshafen
Zeitdiagnostik in Schlüsselbegriffen. Das Glossar der Gegenwart 2.0
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Eberhard-Lämmert-Saal, Eingang Meierottostr. 8, 10719 Berlin
Immer kontroversere Diskurse? Sprachreflexionen zur Berliner Republik
Akademie der Wissenschaften, Karlstraße 4, 69117 Heidelberg
Zeitbegriffe und die Temporalstruktur der Moderne
Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, Am Neuen Markt 9d, 14467 Potsdam
Das Skandalon der Philosophie. Kritische Theorie und DDR
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Barbara Picht: Denkraum der Besonnenheit. Die Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg in Hamburg
Schloss Assenheim
Jüdisches Geld gegenüber christlichen Waren. Marx’ »Zur Judenfrage« in seinem »Kapital«
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Barbara Picht: Begriffsgeschichtsforschung im Kalten Krieg. Werner Conze und Werner Krauss
Universität Bern, Unitobler, Raum F023, Lerchenweg 36, 3012 Bern, Schweiz
Ernst Müller: Gibt es im 20. Jahrhundert eine neue Sattelzeit? Zum Lexikon »Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen«
Universität Bern, Unitobler, Raum F023, Lerchenweg 36, 3012 Bern, Schweiz
»Leipzig liest«: Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen
Leipziger Buchmesse, Halle 5, Forum Sachbuch
Falko Schmieder: Reinhart Koselleck und die Interdisziplinarität der Begriffe
Universität Bern, Unitobler, Raum F023, Lerchenweg 36, 3012 Bern, Schweiz
Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Pariser Str. 1, 10719 Berlin
Walter Benjamin und die Kultur der Revolte
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Der »Verein freier Menschen« – zu Marx’ irreführender Utopie
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Von der Judenemanzipation zum Atheismus: die Genese der Religionskritik bei Marx
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Fragmente aus der Endzeit. Die Zeitdiagnosen von Günther Anders
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Falko Schmieder: Die ökologische Krise im Werk von Reinhart Koselleck
Università di Bologna, San Giovanni in Monte, Aula Giorgio Prodi
Mit Koselleck über Koselleck hinaus. Perspektiven zu einer Begriffsgeschichte des 20. Jahrhunderts
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Pariser Str. 1, 10719 Berlin
Barbara Picht, Kerstin Schoor: Stimmen des Exils. Emigrant:innen in Radio-Interviews
Mendelssohn-Remise, Jägerstraße 51, 10117 Berlin
Mensch ohne Welt
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Gebrauchsweisen und Aktualität des Werks von Reinhart Koselleck
Deutsches Literaturarchiv Marbach, Schillerhöhe 8–10, 71672 Marbach am Neckar, Tagungsraum 2–3
Alexander Friedrich, Petra Gehring, Ute Volkmann: Am gläsernen Schreibtisch. Über Wissenschaftstracker, Profiler und Datenhändler
Online (Zoom) & Kulturwissenschaftliches Institut Essen (KWI), Gartensaal, Goethestraße 31, 45128 Essen
Alexander Friedrich, Stefan Scholl, Simon Specht: Begriffsgeschichte in der Digitalen Gegenwart
Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Gisonenweg 5–7, 35037 Marburg
Falko Schmieder, Birgit Ziener: Gilles Deleuze, Félix Guattari: Anti-Ödipus. Kapitalismus & Schizophrenie I
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Hegels Begriffe begreifen
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Dialektik der Aufklärung: »Bilder als Schrift entziffern« – Strategien einer »neuen« Aufklärung?
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Aufgang B, 3. Et., Trajekte-Tagungsraum
Ernst Müller: Begriffsarbeit im Projekt »Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen«
Freie Universität Berlin
Alexander Friedrich: Herausforderung digitaler Begriffsarbeit am Beispiel von »Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen«
Freie Universität Berlin
Falko Schmieder, Christian Voller, Sebastian Tränkle: Sprachkritik als Ideologiekritik
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Unvollendetes, Zerbrochenes, Verlorenes: Über das Fragment
Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow, Goldschmidtstraße 28, 04103 Leipzig
Falko Schmieder: Nachhaltigkeit als Ideologie
Universität Bonn, Am Hof 1, 53113 Bonn
Ökologische Grundbegriffe im 20. Jahrhundert
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Aufgang B, 3. Et., Trajekte-Tagungsraum
Johann Gottlieb Fichte – Transzendentale Logik und gesellschaftlicher Fortschritt
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Kritik der Aufklärung. Und warum wir sie dennoch dringender denn je brauchen
Einstein Forum, Am Neuen Markt 7, 14467 Potsdam / Livestream via Zoom
Barbara Picht: Aby Warburg und Ernst Robert Curtius
Sapienza Università di Roma, Dipartimento SEAI, Sede Marco Polo, Via Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma, Italien
In der Dämmerung. Christian Voller und Falko Schmieder im Gespräch über die Vor- und Frühgeschichte der Kritischen Theorie
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Ernst Müller/Falko Schmieder: Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen – Das Konzept eines neuen Lexikons
FernUniversität in Hagen, Gebäude 2, Raum 1–3, Universitätsstraße 33, 58097 Hagen
Falko Schmieder: Zur Aneignung des Marx’schen Fetischbegriffs bei Walter Benjamin und Roland Barthes
Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Germanistik, Mozartgasse 8, 8010 Graz, Österreich
Wert- und Traditionsbegriffe
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Aufgang B, 3. Et., Trajekte-Tagungsraum
Politisch-soziale Grundbegriffe wissenschaftlicher Provenienz
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Aufgang B, 3. Et., Trajekte-Tagungsraum
Falko Schmieder, Birgit Ziener: Walter Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Estetica e filosofia della storia | Estética y filosofía de la historia | Ästhetik und Geschichtsphilosophie
Università degli Studi del Molise, Campobasso
Auftaktveranstaltung des Projekts »Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen«
Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZfL), Schützenstraße 18, 10117 Berlin, 3. Etage, Trajekte-Tagungsraum / Zoom
Doris Liebscher, Falko Schmieder: »Rasse« im Recht gegen Rassismus?
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin Kopenhagener Str. 9 10437 Berlin
Epochenschwellen und Epochenzäsuren
ZfL, Schützenstr. 18, 10117 Berlin, Aufgang B, 3. Etage, Seminarraum
Falko Schmieder: Odo Marquards Kritik der Geschichtsphilosophie und sein Gegenprogramm der Kompensation
Universitat de València
Ernst Müller: Der Begriff »Entzweiung« bei Joachim Ritter
Universitat de València
Barbara Picht: Der Beitrag der Ritter-Schule zum Historischen Wörterbuch der Philosophie
Universitat de València
Die »Vorträge der Bibliothek Warburg«. Das intellektuelle Netzwerk der KBW, Teil II
Warburg-Haus, Heilwigstraße 116, 20249 Hamburg
Ernst Müller: Fakultäten/Universitätenstreit
Universidad de Salamanca
Henning Trüper: Rescuing the dead from oblivion: humanitarian morality and historical discourse
Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe, Edificio Ortega y Gasset
Ernst Müller: Die Entdeckung des Gefühlswerts in der Begriffsgeschichte
Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe, Edificio Ortega y Gasset
Falko Schmieder: Der Überlebensbegriff als Instrument der angstpolitischen Kolonialisierung des Alltagslebens im Atomkriegs- und Ökologiediskurs
Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe, Edificio Ortega y Gasset
Barbara Picht: Angst. Wie schreibt man ihre Geschichte?
Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe, Edificio Ortega y Gasset
Barbara Picht: »Das 20. Jahrhundert wechselt sein Aussehen je nach Blickwinkel«. West- und östliches Europa aus der Perspektive des polnischen Schriftstellers Czesław Miłosz
Helle Panke e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin
Aufgaben und Methoden der Begriffsforschung: Die Beispiele Staat und Politik
Freie Universität Berlin, DFG KFG 2615 - Rethinking Oriental Despotism, Fabeckstr. 15, 14195 Berlin
Medienecho
Ein neues Lexikon entsteht: Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen. 30 Artikel stehen schon online. Der Historiker Kristoffer Klammer hat zum Stichwort »Autorität« geschrieben. Interview mit Kristoffer Klammer, in: SWR 2
Empfehlung von Oliver Weber, in: »Die Weihnachtsempfehlungen der Redaktion«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 276 (26.11.2025), 11
Interview von Matthias Heine mit Falko Schmieder, in: Welt (8.7.2024)
Rezension von Thomas Thiel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 124 (29.5.2024), N4
Tagungsbericht von Simon Specht, in: H-Soz-Kult, 15.12.2023
Rezension von Peter Tietze, in: Archiv für Begriffsgeschichte 64.2 (2022), 181–187
Besprechung von Thomas Thiel, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 202 (31.8.2022), N4
Rezension von Joan Gallego Monzó zum Sammelband Crítica de la Modernidad. Modernidad de la crítica (Una aproximación histórico-conceptual), hg. von Faustino Oncina Coves, mit Beiträgen von Ernst Müller, Barbara Picht und Falko Schmieder u.a., in: Quaderns de filosofia 8.1 (2021), 129–134 (auf Katalanisch)
Beiträge
|
Bücher im Gespräch |
16.7.2024 Audio
»Ein Nachschlagewerk zum 20. Jahrhundert«
Interview mit Falko Schmieder im WDR
© WDR